Unser tägliches Brot: ein Plädoyer für umfassende Medienbildung | Themenbeitrag
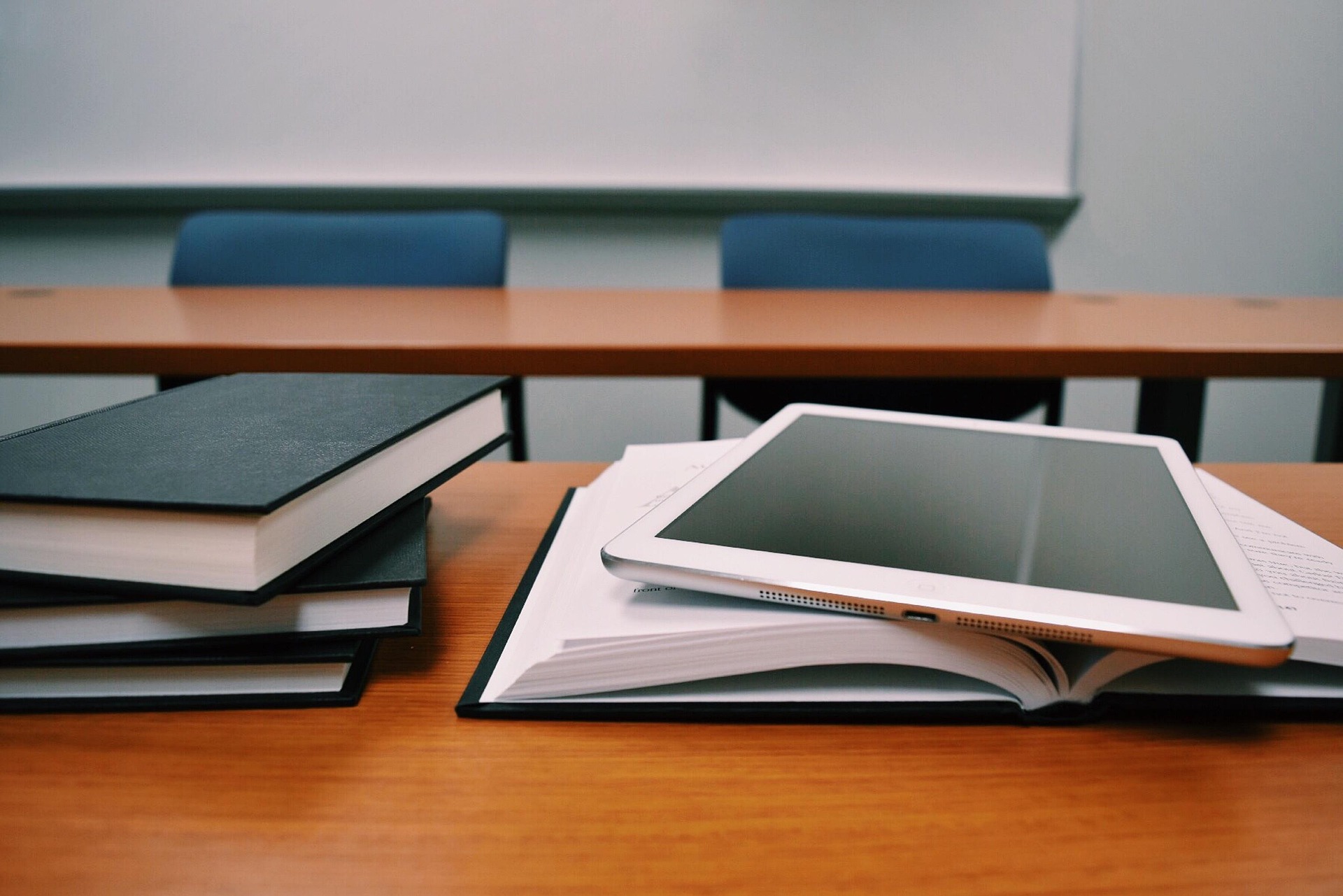
Die Teilhabe an politischen, kulturellen und ökonomischen Prozessen innerhalb der Gesellschaft setzt Fähigkeiten im Umgang mit und zur Analyse, Reflexion und Gestaltung von digitalen Phänomenen voraus. Erforderlich hierfür ist die Kenntnis der informatischen Grundlagen sowie der medienwissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Zugänge und Diskurse. Der digitale Wandel prägt die sozialen Kommunikations- und Interaktionsbedingungen sowie die politische Organisation von Gesellschaften. Er bildet dabei nicht zuletzt auch einen kulturellen Möglichkeitsraum, der von Gesellschaften genutzt und gestaltet werden kann. Unter den Bedingungen digitaler Infrastrukturen wird das Erkennen und die Bewertung medialer Einflüsse sowie die aktive Teilhabe an gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen voraussetzungsreicher. Sie erfordern Hintergrundwissen und spezifische Kompetenzen sind das Beurteilen von Information oder die Entwicklung eigener Standpunkte. Hierbei lassen sich widersprüchliche Tendenzen feststellen: die erhöhten Partizipationsmöglichkeiten steigern den potentiellen Einfluss von Individuen, wohingegen die wachsende Komplexität einer digital gewandelten/beeinflussten Kultur und die Geschlossenheit autonomer und/oder selbstlernender Systeme den individuellen und gesellschaftlichen Ein- und Zugriff wiederum erschweren.
Heutzutage beschützen Eltern ihre Kinder in der realen Welt übermässig, während sie sie in der virtuellen Welt unzureichend schützen
Digitalisierte Kindheit
Zu beobachten ist der Rückgang der spielbasierten Kindheit, der in den 1980er Jahren begann und sich in den 1990er Jahren beschleunigte. Viele Eltern begannen, den Zugang ihrer Kinder zu unbeaufsichtigtem Outdoor-Spiel aus mediengeförderten Ängsten um ihre Sicherheit zu reduzieren. Der Verlust des freien Spiels und der Anstieg der kontinuierlichen Erwachsenenaufsicht beraubte die Kinder dessen, was sie am meisten benötigten, um die normalen Ängste und Sorgen der Kindheit zu überwinden: die Chance, zu erkunden, ihre Grenzen zu testen und zu erweitern, enge Freundschaften durch gemeinsame Abenteuer aufzubauen und zu lernen, Risiken selbst einzuschätzen. Stattdessen gab es den Anstieg der smartphonebasierten Kindheit, die Ende der 2000er Jahre begann und sich zu Beginn der 2010er Jahre beschleunigte. Diese waren mit sozialen Medienplattformen ausgestattet, die durch das neue Hochgeschwindigkeitsinternet und unbegrenzten Zugang unterstützt wurden. Heutzutage beschützen Eltern ihre Kinder in der realen Welt übermässig, während sie sie in der virtuellen Welt unzureichend schützen der amerikanische Psychologe Haidt hat das hinreichend in seinem Bestseller belegt.
Erschwerend kommt hinzu, dass die digitalen Medien uns fest im Griff haben, das rund um die Uhr. Wir können sie gar nicht mehr loslassen, sie bestimmen viel stärker über uns, als dass wir über ihre Anwendung bestimmen. Unser aller Alltag ist nicht mehr vorstellbar ohne Handy und Internet. Die Digitalisierung schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran und durchdringt unser Leben zunehmend, sogar unser Hirn. Vor allem haben sie die Welt der Kinder und Jugendlichen ergriffen. Es gibt zahlreiche Studien, die mehrheitlich von negativen Auswirkungen der digitalen Medien auf die Gesundheit unserer Kinder ausgehen. Aber selbst Erwachsene erfahren körperliche und psychische Beeinträchtigungen durch die häufige Verwendung digitaler Medien.
Immer mehr der Digitalisierung geschieht auf heimtückische Art, was sogar als Bedrohung von Demokratie und Freiheit angesehen wird. Dazu konzentriert sich Kriminalität zunehmend aufs Netz. Cybercrime nimmt im Gegensatz zu offline Straftaten massiv zu, es lässt sich damit mehr Geld verdienen als die 5 erfolgreichsten Unternehmen weltweit verdienen. Die letzte Ausgabe von EU Kids Online berichtet, dass in der Schweiz bereits 26% der 9/10-Jährigen mit mindestens einem der untersuchten Online Risiken in Kontakt kamen. Dieser Anteil steigt mit zunehmendem Alter auf 94% bei den 15/16-Jährigen an (Hermida, 2019). In meiner eigenen Studie MEKIDA waren nur 5.2% der untersuchten Kinder und Jugendlichen frei von Onlinerisiken, das bei einem Index mit 18 Gefährdungen (u.a. digitale Süchte, Cyberbullying, Cybergrooming, Cyberhate). Weitere Erkenntnisse: Je höher die Schicht, desto höher der Index. Höher ist er auch bei Mädchen, nichteuropäischen Kindern, 11-14-jährigen und in der Regelschule. Keinen Einfluss hatte die familiäre Situation. Diese Zahlen belegen eindrücklich, wie vordinglich Medienbildung als festes Schulfach ist und gerade da, wo man es am wenigsten erwartet.
Gefahren und Chancen für die Demokratie
[D]ie Befähigung zu kritischer und selbstbestimmter Mediennutzung [ist] dringender und wichtiger denn je
Bis jetzt grob unterschätzt wird die wachsende Gefahr für unsere Demokratie und Freiheit. Die deutsche Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) forderte dieses Jahr mit ihrem „Berliner Plädoyer“ eine nationale Bildungsoffensive zur Stärkung von Medienkompetenz und Demokratiebildung als wichtige Voraussetzung zur Bewahrung der demokratischen Werte und Institutionen. Insgesamt haben 530 Einzelpersonen und Institutionen aus der medienpädagogischen Forschung und Praxis sowie der politischen Bildung das Plädoyer unterzeichnet und damit ein deutliches Signal für eine umfassende und nachhaltige Förderung von Medienkompetenz und Demokratiebildung gesetzt. In einer Zeit zunehmender Verbreitung von Desinformationen und Hass im Netz sowie wachsendem Druck auf demokratische Strukturen ist die Befähigung zu kritischer und selbstbestimmter Mediennutzung dringender und wichtiger denn je“, so GMK-Vorstand Rüdiger Fries.
Dabei muss man sich im Klaren sein, dass das alle Parteien betrifft, da die Manipulationstools von allen genutzt werden können, zum jeweils eigenen Nachteil. Wer demokratisch denkt, muss das Volk entscheiden lassen, und nicht den Algorithmus.
Dennoch existiert ein Dilemma: Je mehr Kinder Zugang zum Internet erhalten, desto eher können diese Formen digitaler Ausgrenzung und Ungleichheit überwinden. Gleichzeitig sind Kinder aber auch stärker Online-Gefahren ausgesetzt. Dies sind besorgniserregende Entwicklungen, wobei weitgehend unbekannt ist, wie sich diese zueinander verhalten. Wie wird durch diese Medienphänomene unsere psychische Gesundheit verändert? Können diese gar zu Beeinträchtigungen oder Behinderungen führen oder verschlimmern? Oder ist das nur mediale Hysterie, die Kinder und Jugendliche kaum betrifft? Ist es nicht eher so, dass Kinder und Jugendliche mehrheitlich von Medien profitieren? Eine schlüssige Antwort steht noch aus.
Da die digitalen Medien heute so eine grosse Bedeutung haben, selbst Wahlen wie auch unser Gehirn beeinflussen, muss ein guter Umgang mit ihnen geübt werden. Denn die digitalen Medien haben viele Vorteile. Diese müssen nur bekannt sein. Meine Erfahrung mit Kindern und auch die Ergebnisse meiner Studien zeigen, dass diese zwar wissen, wie sie an Computergames kommen, für die sie noch zu jung sind oder andere Alterssperren umgehen können, aber nicht wissen, dass man kostenlos mit der Verwandtschaft in fernen Ländern telefonieren kann, oder dass es Hausaufgabenhilfen gibt. Summa summarum, sie wissen Bescheid über das, was ihnen nicht guttut, aber viel zu wenig über Dinge, die ihnen guttun.
Da alle Menschen digitale Medien benutzen und die konstante Nutzung diese profunden Auswirkungen hat, ist das Erlernen von Medienkompetenz unabdingbar, viel wichtiger als ein Führerschein: Digitale Medien werden durchschnittlich 7.52 Stunden am Tag genutzt, das Auto 19 Minuten, wie Daten aus Deutschland zeigen. Medienkompetenz zu erlernen ist dabei essentiell, denn medienkompetente Schülerinnen und Schüler sind nicht nur besser für die Zukunft gewappnet, sie sind auch besser vor negativen Medienerfahrungen geschützt. Gerade die Schule kann neueste Entwicklungen aufgreifen, Eltern bekommen die oftmals nicht mit. Medienkompetenz ist die Schlüsselqualifikation der Informationsgesellschaft. Medienkompetenz ist vor allem die Fähigkeit, verantwortungsbewusst und kritisch mit digitalen Medien umzugehen sowie ein Verständnis dafür, wie Informationstechnologien funktionieren. Kaum mehr nötig ist, zu vermitteln, wie digitale Medien bedient werden, das wissen heute alle Kinder, oftmals sogar besser als Lehrpersonen.
Medienkompetenz weiter fördern
Doch wie kompetent sind Kinder bezüglich Medien? Kein Kind erreichte das Maximum in der von mir entwickelten Medienkompetenzskala. In dieser musste wahren und falschen Aussagen über digitale Medien zugestimmt werden, wie dass alle genau die gleiche Werbung bekommen, oder dass es auf YouTube Hilfestellung für Hausaufgaben gibt. Die Anzahl richtiger Antworten wurde gewertet. 5.4% in der ersten Befragung bzw. 3.5% in der 2. Befragung erreichten maximal 80%, 3 bzw. 1 Kind erreichte die 90% -Marke. Kein Kind war in den unteren 10%, 9 bzw. 5 Kinder sind in den unteren 20%, was bedeutet, dass zumindest ein Minimalwissen vorhanden ist. Jene mit hoher Medienkompetenz brauchen Handy und soziale Medien öfter, haben eine offenere, aufregendere, selbstreguliertere und empathischere Persönlichkeit, leiden mehr unter FOMO, Nomophobie, werden öfter digital ausgegrenzt, sind gehemmter, böses zu tun im Internet. Selbst mit strengeren Kriterien sind die Zusammenhänge freilich nicht ausgeprägt. Es ist gut, dass die Vielnutzer medienkompetenter sind, sie sind allerdings ängstlicher, wenn sie Medien nicht zur Verfügung haben.
[I]n der Schweiz gibt es immer mehr Kantone, die Handys aus Schulen verbannen, wie Aargau, Wallis, Nidwalden und Waadt. Aber das ist der falsche Weg
Die GMK plädiert dafür, Medienkompetenz als unverzichtbare Basis- und Schlüsselqualifikation zu verstehen und sie durch bildungspolitische Massnahmen strukturell und finanziell auf allen Ebenen langfristig zu stärken. Dies umfasst insbesondere auch den konsequenten Ausbau von medienpädagogischen Angeboten in Kindertagesstätten, Schulen, Universitäten und in der ausserschulischen Bildung. Ähnliches gibt es meines Wissens nicht in der Schweiz. Wohl aber eine Broschüre «Medienkompetenz im Schulalltag». Was fehlt ist die Verbindlichkeit. Auch im Lehrplan 21 ist Medienbildung enthalten, aber den Schulen steht es frei, wie und ob sie es umsetzen. Mehr berücksichtigt wird Informatik und Robotik, aber das schützt Kinder nicht.
Wenig hilfreich ist, dass verschiedene Länder Verbote von Handys an Schulen eingeführt haben, die Erfolge damit sind wenig gesichert. Auch in der Schweiz gibt es immer mehr Kantone, die Handys aus Schulen verbannen, wie Aargau, Wallis, Nidwalden und Waadt. Aber das ist der falsche Weg, denn es gibt die Zeit ausserhalb der Schule. Und Kinder und Jugendliche suchen die Herausforderung, solche Verbote zu umgehen. Sie sind darin wahre Genies. Es muss der bessere Umgang mit digitalen Medien gelernt werden. Immerhin: in Zürich haben mehrere Schulen und Gemeinden zusammen mit Fachpersonen das Projekt Go Offline gestartet, was Eltern helfen soll, den Umgang mit digitalen Medien in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder gut zu gestalten. Informationen dazu gibt es allerdings vor allem online, obwohl das Projekt auf Offline abzielt.
Hier sollte dann die Schule einsetzen, die einen anderen Zugang und eine andere Rolle hat. Diese soll in Medienbildung ausgebildete Lehrpersonen beschäftigen, die Zeit und Musse haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Medienbildung muss ein festes Schulfach sein, wie Lesen oder Rechnen. Dabei kann es durchaus Teile von anderen Fächern übernehmen, etwa einen historischen Film zeigen, dessen Machart ist genauso zu thematisieren wie das historische Ereignis. Es sollte im Kindergarten beginnen, bis zur Matura andauern und selbst in der Universität sollte das Thema sein, da selbst Studierte Mühe haben, Fake News zu erkennen oder sich von falscher politischer Propaganda becircen lassen. Medienbildung betrifft von daher alle Altersgruppen, auch wegen der ständigen Neuerungen, darunter auch Gefahrenquellen. Eltern sollten ebenfalls zwei- bis dreimal im Jahr informiert werden, solange ihre Kinder nicht schulpflichtig sind. Dies sollte verpflichtend sein wie viele andere Sachen im Staat verpflichtend sind, die aber nicht so fundamentale Auswirkungen haben.
Um es auf den Punkt zu bringen: Medienbildung ist heutzutage so wichtig wie unser täglich Brot. Aber während wir dem weitgehend vertrauen können, ist das bei den digitalen Medien nicht der Fall. Immer mehr klagen beim Gebrauch nicht nur über Bauchweh. Alle Schweizer Bildungsinstitutionen sollen sich das zu Herzen nehmen, und Medienbildung zum Unterrichtsfach zu machen, damit letztendlich unser land freiheitlich und demokratisch bleibt, im wahrsten Sinn des Wortes.
Quellen:
Haidt, Jonathan. (2024). Generation Angst. Wie wir unsere Kinder an die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen, Dt. von Jorunn Wissmann; Monika Niehaus. Rowohlt, Hamburg, ISBN 978-3-498-02836-7.
Hermida, Martin. (2019). EU Kids Online Schweiz 2019. Schweizer Kinder und Jugendliche im Internet: Risiken und Chancen. Schwyz: PH Schwyz.
Hättich, Achim. (2022). Zwischenbericht MEKIDA. Zürich: ZHAW.
GMK e.V. (2024). Berliner Plädoyer für mehr Medienkompetenz und Demokratiebildung. Bielefeld.
Was sind Themenbeiträge?
Themenbeiträge greifen Aspekte unserer Kernthemen sachlich oder philosophisch auf.
Die Texte können sowohl von internen als auch externen Autoren stammen.
Sie sollen zum Denken im Rahmen der Themengebiete anregen und müssen nicht zwangsläufig der Meinung der Piratenpartei entsprechen.
